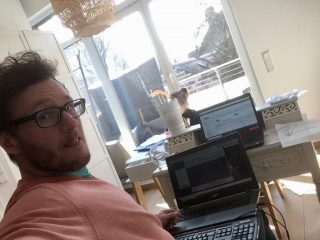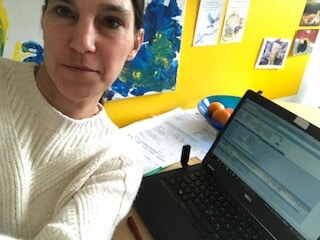Für fast alle hat sich der Arbeitsalltag durch die Corona-Pandemie verändert. Egal ob Homeoffice, Kurzarbeit oder Überstunden – Arbeiten ist anders geworden. Wir haben kurze Geschichten gesammelt, eine besondere Begegnung oder ein eindrückliches Erlebnis von Menschen aus Bayern in ihrem Arbeitsalltag in anderen Zeiten. Sie können Sie hier nachlesen oder als PDF herunterladen.

Kinder, Haushalt, Arbeit – alles fließt ineinander
Ich bin Assistentin bei einem Finanzinvestor. Meine Arbeit geht auch in Zeiten von Corona weiter, aber es ist eine etwas ruhigere Phase. Eine meiner Aufgaben besteht darin, Reisen und Meetings zu planen. Das fällt zurzeit natürlich weg. Neue Projekte gibt es auch erstmal nicht, denn auch im Finanzsektor steht jetzt vieles still.
Anfangs war ich komplett im Home-Office. Die ersten Wochen fand ich sogar schön, weil ich keine Termine mehr hatte, alles war entschleunigt und heruntergefahren. Ich fand es auch ganz angenehm, dass man nur noch Essen einkaufen konnte. Es war wie eine Fastenzeit. Da habe ich gesehen, was ich wirklich brauche und was eigentlich Ballast ist. Dann ist es gekippt. Ich habe die Kontakte im Büro sehr vermisst, den Austausch auf Erwachsenen–Ebene. Ich habe zwei kleine Söhne von drei und fünf Jahren, die mein Mann und ich im Wechsel zuhause betreuen. Home-Office mit Kindern ist eine andere Art von Stress als im Büro. Man kann nichts richtig zu Ende machen, einmal muss ich die Kinder stehen lassen, dann wieder meine Arbeit am Computer. Was dabei tierisch nervt, ist das völlige Aufweichen von Zeit: Kinder, Haushalt, Arbeit – alles fließt ineinander und lässt sich nicht mehr trennen. Es wird viel schwieriger, Struktur in den Tag zu bringen. Da wird man unzufrieden, weil alles so verschwimmt. Man kriegt nichts gescheit fertig.
Jetzt gehe ich wieder ein bis zwei Nachmittage ins Büro, das ist schon besser. Da kann ich mal wieder konzentriert eine Sache zu Ende machen. Es hat mir gefehlt, einen Platz zu haben, wo ich nur ein erwachsener, berufstätiger Mensch sein kann und nicht noch Mutter, Partnerin und Hausfrau gleichzeitig. Die ganze Zeit 100 Prozent zuhause zu arbeiten, hätte ich auf Dauer nicht gut ausgehalten. Für die Kinder wäre es auch gut, wenn die Kita und ihr sonstiger Alltag wieder losgingen. Sie vermissen ihre Freunde und ihr soziales Umfeld. Auf der anderen Seite ist es für sie auch etwas entspannter ohne Termine wie Tanzkurs oder Fußball-Training. Wir verbringen dafür jeden Tag gemeinsame Zeit im Park oder im Wald.
Mein Mann und ich sind im Vergleich zu vielen anderen Menschen eigentlich in einer privilegierten Situation, weil wir beide nicht um unsere Arbeitsplätze fürchten müssen und unser Gehalt weiter bekommen. Es gibt mir Kraft, mir bewusst zu machen, dass es mir gut geht. Seit ich viel zuhause bin, habe ich mir angewöhnt, dass ich einmal am Tag 15 bis 60 Minuten das tue, was mir guttut. Ich merke inzwischen, wann ich mich rausnehmen muss, um zu entspannen. Meistens mache ich Yoga. Früher war ich immer zu abgelenkt dafür, aber zuletzt konnte ich mich gut darauf konzentrieren. Ich hoffe, ich kann das beibehalten, denn es ist ein notwendiger Ausgleich in diesen Zeiten.
Stephanie, 42 Jahre, Assistentin bei einem Finanzinvestor
Antrag auf Arbeitslosengeld ist frustrierend
Erstmal ging von heute auf morgen ja gar nichts mehr, als die Schulen und Kitas zugemacht haben in denen ich täglich musikalische Früherziehung und Blockflötenunterricht gebe. Ich war wirklich in der Schwebe, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Auch von den privaten Schülern hat sukzessive einer nach dem anderen den Klavierunterricht abgesagt – bis es nur noch einen Einzelkämpfer gab, der bis zum Schluss geblieben ist. Man ist froh und dankbar über jeden der kommt. Dann habe ich relativ schnell Skype eingerichtet, um weiterhin unterrichten zu können, aber die Reaktionen waren nicht überwältigend. Insgesamt habe ich gemerkt, dass der shut down und die Umstellung auch für die Schüler eine Überforderung war.
Auf eine Antwort zu unseren Anträgen auf Soforthilfe haben wir vier lange Wochen gewartet. Und dann hieß es: Ich kriege kein Geld, weil ich als selbständige Musikpädagogin keine Mieträume, kein Klavier, das abbezahlt werden muss, keinen Firmenwagen und keine Angestellten habe. Die Begründung für die Ablehnung war: Wir finanzieren nicht ihren Lebensunterhalt. Ja, wovon soll ich denn leben? Wenn du Kredite hast, wird das unterstützt. Aber wenn du mit dir im Reinen bist, musst du schauen wo du bleibst. Was bleibt, ist ein Antrag auf Arbeitslosengeld II. Das ist frustrierend.
In den Kitas kann ich jetzt zwar keine Aushänge für die nächsten Kurse machen aber ich kann immerhin wieder zu den privaten Schülern fahren. Mit Kontakt kannst du ganz anders unterrichten als über Skype. Das ist einfach persönlicher, gerade wenn man den Schülern etwas vorspielt. Allerdings sind meine Arbeitswege länger und die Zeitplanung aufwendiger, weil mein Schülerumfeld verstreut im Einzugsgebiet Nürnberg und Umland liegt, sozusagen von Rehof bis Poppenreuth. Mit dem Rad ist das zeitlich kaum zu schaffen.
Es ist schön, dass ich die Zeit mit meinen eigenen Kindern verbringen darf. Wir haben zusammen Musik gemacht und manchmal „hospitiere“ ich heimlich bei den Online-Vorlesungen der Uni Pforzheim, die mein Sohn sich anhört. Das ist richtig spannend.
Maria, 46 Jahre, selbständige Musikdozentin für Klavier, Blockflöte, musikalische Früherziehung, Chorleitung
Zuversicht trotz Ungewissheit
Nach einer Lehre zum Industriemechaniker habe ich mehrere Jahre als Servicetechniker im familiären Betrieb gearbeitet. Nach einer zweijährigen Weiterbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechnik bin ich seit knapp einem Jahr im technischen Vertrieb und als stellvertretender Geschäftsführer tätig.
Corona hat schon einiges für mich verändert. Zum einen hat sich mein Arbeitsalltag komplett gewandelt. Ich bin nur noch jede zweite Woche in der Firma und arbeite von meinem Büro aus – sonst arbeite ich von zu Hause aus. Die Umsetzung der Auflagen sowie die Organisation des Geschäftsbetriebs nimmt momentan einen großen Teil meiner Arbeitszeiten ein. Zum anderen hat sich der Umgang mit den Kunden sehr verändert. Persönliche Kontakte finden so gut wie nicht mehr statt, was den Vertrieb deutlich erschwert. Viele Firmen arbeiten nur auf Teilzeit, weswegen die entsprechenden Ansprechpartner schwer zu erreichen sind. Zudem werden viele Projekte auf Eis gelegt, da niemand weiß, wie lange uns die wirtschaftlichen Folgen begleiten werden.
Es ist sehr ungewohnt, innerhalb von wenigen Tage oder Wochen seinen Arbeitsalltag komplett auf den Kopf zu stellen. Dazu kommt die wirtschaftliche Ungewissheit, die man nur bedingt beeinflussen kann. Überraschend finde ich, dass die gesamte Belegschaft in so einem massiven Ausmaß an einem Strang zieht und jeder noch näher zusammenrückt. Unsere Firma gibt es seit 60 Jahren und drei Generationen. Sie konnte in dieser Zeit allen Widrigkeiten trotzen. Das gibt mir Zuversicht, dass wir auch diese Krise meistern.
Matthias, 27 Jahre, technischer Vertrieb und Stellv. Geschäftsleitung bei Druckluft Könitzer
Plausch mit Kollegen fehlt
Klar trifft auch uns in der Industrie die Krise. Für mich persönlich ist aber vor allem der Bereich außerhalb des Werks betroffen. Der Weg in die Arbeit geht schneller und man findet immer einen Parkplatz. Die Schichten sind so geändert, dass man keinen Kontakt zur anderen Schicht hat.
Ich bin mir nicht sicher ob all die Masken wirklich etwas bringen. Auf der einen Seite empfinde ich diese ganzen Maßnahmen ein bisschen als Bevormundung, auf der anderen Seite stören mich schon auch Menschen die sich nicht an den Mindestabstand halten, obwohl sie vielleicht sogar zur Risikogruppe gehören
Wirklich fehlen tut mir nix, außer der Plausch mit den Kollegen beim Schichtwechsel. Mich überrascht, dass wohl die Luftwerte während dem Lockdown trotz weniger Autoverkehr nicht wirklich besser geworden sind. Und diese Klopapier- und Nudelsammler zu Beginn der Maßnahmen. Krass, was die Leute so horten.
Kraft gab mir in dieser Zeit vor allem mein Hobby. Da ich Whiskey-Sammler bin, habe ich mich auch gerne mal ein bisschen von Innen desinfiziert. Aber auch nicht mehr als sonst.
Christian, 37 Jahre, Schreiner bei Siemens
Kirche ohne Gesang schwer vorstellbar
Im Berufsleben als Verwaltungsangestellte bei der Krankenhausseelsorge bekleidete ich schon diverse ehrenamtliche Tätigkeiten in meiner Kirchengemeinde. Seit ich im Ruhestand bin, mache ich einmal wöchentlich Seelsorgebesuche im Klinikum Nürnberg Nord und Jubiläums- und Geburtstagsbesuche in meiner Kirchengemeinde St. Andreas. Seit über 20 Jahren bin ich dort auch als Mesnerin angestellt. Für fast alle diese Aktivitäten bedeutet die Corona-Kontaktsperre einen Stillstand, der immer noch anhält.
Ich vermisse meine Seelsorgebesuche in der Klinik. Die mir zugeteilte Station wurde sehr schnell geschlossen und für den Corona-Notfall umfunktioniert. Es beschäftigt mich schon, wo sich die zuletzt von mir betreuten gerontopsychiatrischen Patienten und Patientinnen, die ich in der Regel über Wochen begleitet habe, nun befinden und wie es ihnen wohl ergehen mag. Die Geburtstagsbesuche in der Gemeinde haben sich auf kurze Begegnungen im vorgeschriebenen Abstand an der Haustür oder ein paar schriftliche, persönliche Worte über den Briefkasten reduziert.
Als Mesnerin halte ich mich nach wie vor einige Male in der Woche im Kirchenraum auf. Blumenschmuck, Paramente, Betreuung der Schaukästen, alles wird dem Kirchenjahr entsprechend weiter gehandhabt. Aber es fehlen mir die sonntäglichen Gottesdienste. Seit der Karwoche gibt es stundenweise Kirchenöffnungen, die erfreulicherweise auch wieder persönliche Begegnungen im Rahmen der Vorschriften ermöglichen.
Mit mir gut vertrauten, älteren Gemeindegliedern telefoniere ich regelmäßig. Es ist erfreulich, zu erfahren, dass die meisten rundum gut vernetzt und versorgt sind. Es überrascht aber auch, welch großes Rede- und Mitteilungsbedürfnis sich doch bei so manchem und mancher angestaut hat. Erstaunlich dabei ist, dass im Wesentlichen die bisherige Lebenssituation und Krankheiten vordergründig sind und Corona nur als Randerscheinung auftritt.
Mit der Vorstellung, dass in Kirchen erst einmal möglichst nicht gesungen werden soll, tue ich mich schwer, obwohl es ja erwiesen ist, dass da eine große Infektionsgefahr besteht. Die Proben in unserem Ökumenischen Chor, dem mein Mann und ich seit über 30 Jahren angehören, vermisse ich ganz besonders.
Zuhause kommen mein Mann und ich gut zurecht. Wir stellen beide fest, dass wir so viel gar nicht vermissen, weil wir uns beschäftigen und wenn es nötig erscheint, räumlich aus dem Weg gehen können. Halt und Kraft suche ich in Worten aus dem Römerbrief: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ und mein sehnlichster Wunsch geht in die Richtung, dass einfach wieder Normalität einkehren möge.
Elfriede, 71 Jahre, Mesnerin, Klinik-Seelsorgerin
Jeder hat überall mit hingelangt
Ich habe die Tafel in Dachau mit aufgebaut und bin seit 18 Jahren hier die Leiterin. Alles war neu in der Krise. Mit den Kunden durften wir nicht mehr in Kontakt kommen. Wir hatten nicht mal eine Woche geschlossen, da kam schon der Druck aus der Bevölkerung: „Ihr könnt die armen Leute doch nicht ohne Essen lassen“. Dann haben wir angefangen zu liefern. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch wenig Ware, also haben wir Ware dazu gekauft. Wir haben die Adressen der Kunden gespeichert. Wegen dem Datenschutz durften aber nur unsere eigenen Mitarbeiter ausliefern und keine externen zusätzlich.
Jede Woche haben wir überlegt, wie wir es effektiver machen können. In den letzten Wochen haben wir Tüten gekauft und haben sie über die Durchreiche raus gereicht an die Kunden. Das Packen der Tüten war sehr aufwendig. Wenn wir Lieferungen bekamen, mussten wir zum Beispiel Brot erst mal einfrieren, weil es ja alt wird, wenn die Leute es nicht gleich mitnehmen können. Diese Woche haben wir es wieder ganz umgestellt – die Kunden dürfen wieder rein. Es gibt feste Zeiten, wann sie kommen dürfen: Pro halbe Stunde 10 Leute. Mit Abstand und Maske dürfen sie sich an den Ständen ihre Lebensmittel aussuchen.
Das waren jetzt sieben sehr anstrengende Wochen. Ich habe normal 70 Mitarbeitende, jetzt arbeite ich mit 11. Also gab es viel zu organisieren. Das war viel aufwendiger als sonst und ich war dauernd am Pläne schreiben. Es waren lange Tage – manchmal bis zu 10 Stunden und alle Mitarbeitenden haben gesagt, ihre Familien haben gelitten in dieser Zeit.
Aber ich bin stolz. Wir konnten die versorgen, die sich gemeldet haben. Wir waren ein tolles Team, haben das gemeinsam gestemmt. Der Zusammenhalt war super. Jeder hat überall mit hingelangt. Es war gigantisch. Unsere Kunden sind total dankbar, haben sich 1000 mal bedankt und mir sogar Flieder gebracht. Alle waren sehr vernünftig und haben sich an die Regeln gehalten. Es war heftig, aber meine Mitarbeitenden haben mir Kraft gegeben und auch mein Mann. Der hat mich motiviert und aufgebaut.
Edda, 72 Jahre, Leiterin der Dachauer Tafel
Es ist vieles gut geregelt
Ich bin Buchhalter bei einem Reiseveranstalter für Gruppenreisen rund um die Welt. Dort bin ich seit 20 Jahren tätig. Die Tourismusbranche ist mit der Gastronomie am stärksten von Corona betroffen. Wir sind nicht mehr handlungsfähig. Kein Zug fährt, kein Flieger startet. Auch in Deutschland ist es bisher schwierig, weil Hotels immer noch geschlossen sind. Unser Schwerpunkt sind Fernreisen. Wir verkaufen nichts Last Minute. Unsere Angebote werden lange im Voraus geplant. Die Arbeit, die wir für dieses Jahr investiert haben, wurden zunichtegemacht. Unsere Existenz steht auf dem Spiel. Wir sind ein kleines Unternehmen mit knapp über 20 Mitarbeitenden. Wenn wir keine Unterstützung bekommen, laufen wir Gefahr, pleite zu gehen wie viele andere auch.
Meine Kollegen sind auf 100 Prozent in Kurzarbeit. Ich und mein Chef sind im Home-Office. Ein Schock war es nicht für mich, weil ich auch vorher schon Home-Office gemacht habe. Trotzdem ist es ungewohnt. Früher waren die Kinder in der Schule und die Frau auch in der Arbeit. Jetzt sind wir hier alle in einem Raum. Aber wir arrangieren uns. Einmal pro Woche bin ich im Büro, weil es Überweisungen gibt und ich Unterschriften leisten muss. Ich vermisse den Kontakt mit den Kollegen. Der alltägliche Spaß und Stress mit ihnen fehlt mir. Aber ich sehe auch die positiven Seiten. Ich muss nicht so viel pendeln. Wir können viel über Mails regeln. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Für immer möchte ich das allerdings nicht. Es wird auch wieder schön, wenn wir uns life und face to face treffen.
Ich glaube an Gott und damit auch, dass es einen Sinn hat, dass es so gekommen ist mit der Pandemie. Das hilft mir, Geduld zu haben und auf das Positive zu sehen. In Deutschland gibt es einen sehr starken Sozialstaat. Vieles ist gut geregelt. Das gibt mir Sicherheit, dass wir nicht von heute auf morgen nichts mehr zu essen haben und das meine Familie geschützt ist. Ich komme aus Albanien/ Kosovo, wo Armut noch etwas ganz Anderes bedeutet als hier in Deutschland. In Relation dazu geht es uns hier gut. Das mache ich mir immer wieder bewusst.
Milazim, 50 Jahre, Buchhalter bei einem Reiseveranstalter
Man kommt zur Besinnung
Seit 1976 verkaufen wir in unserem Laden „musicandbooks“ Schallplatten, Bücher, CDs, Dvds , bluerays und Noten. Normalerweise sind meine Frau und ich von früh bis spät im Laden. Wir machen praktisch alles selber und haben nur eine 7-Stunden-Kraft eingestellt. Seitdem der Laden geschlossen ist, arbeiten wir von früh ungefähr vier bis fünf Stunden: Räumen auf, sortieren aus und stellen neue Ware in die Regale ein. Der Laden ist jetzt blitzblank und ich bin schon um 14.00 Uhr zu Hause. Wenn die Kunden nächste Woche wiederkommen, werden sie staunen!
Mir fehlen meine Kunden, vor allem die Gespräche, und mein Arbeitsalltag, den ich ja mag. Der Laden hatte immer seine eigene Dynamik, die ich erfüllen muss, damit er läuft. Wir mussten jetzt sechs Wochen schließen und haben auch Soforthilfe bekommen, aber da stirbt man nicht gleich wenn man einen eingeführten Laden hat. Natürlich kaufe ich etwas vorsichtiger Ware an. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand 1000 Schallplatten anbietet, muss ich schauen, ob es passt. Auch wenn wir in einem halben Jahr wieder schließen müssten, weil eine zweite Krankheitswelle anrollt, bin ich darauf vorbereitet.
Ich genieße die Zeit und habe gemerkt, wie schön Freizeit ist. Wir kochen wieder mehr und gehen fast jeden zweiten Tag in den Wald spazieren. Und ich versuche das Intervallfasten durchzuziehen. Das geht viel besser, wenn du nicht so stressig arbeitest und irgendwas zwischendurch isst. Ganz ehrlich, ich finde diese Phase eher positiv als negativ. Man kommt zur Besinnung. Es macht einfach Spaß, Zeit zu haben und den Tag auf sich zukommen zu lassen.
Ich wollte vorher schon Dinge mit dem Laden und dem Leben ändern und jetzt ist es soweit.
Wir werden die Öffnungszeiten kürzen und anstatt am Sonntagvormittag zu arbeiten, werde ich lieber in den Wald oder ins Schwimmbad gehen. 50-60 Stunden Arbeit ist einfach zu viel. Das ist mir dann auch egal, ob ich weniger verdiene: Du kannst sowieso nicht mehr als ein Schnitzel essen! Der Laden hält mich fit, aber ich werde mir keinen Termin setzen, wann ich aufhöre, nach dem Motto: Ich arbeite jetzt noch neun Jahre, dann bin ich 80 und höre auf. Die Arbeit wird sich in dem Maße ändern wie sich das Leben ändert. Da ich keine große Rente zu erwarten habe, gibt es sowieso keinen bestimmten Zeitpunkt.
Norbert, 71 Jahre, Einzelhandelskaufmann
Viel zusätzlicher Druck
Als Krankenpfleger in einem breit aufgestellten Krankenhaus mit Notfallversorgung in der Region München stehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen derzeit an der Front. Wir spüren alle einen erhöhten mentalen Druck durch eine potenzielle Eskalation der Covid-Pandemie. Die Angespanntheit der Kolleginnen und Kollegen ist groß – auch weil durch Covid-Infektionen und weitere Krankheitsausfälle die Belastung gestiegen ist. Zudem wissen wir, dass nun jederzeit unsere Arbeitszeit auf zwölf Stunden am Tag erweitert werden kann, Pausen und Ruhezeiten reduziert werden können. Die Aufhebung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung durch das Bundesgesundheitsministerium tut ihr Übriges zur Arbeitsverdichtung.
Leider erlebe ich wenig Unterstützung von Seiten unseres Arbeitgebers, vielmehr zusätzlichen Druck. So sind wir zwar mündlich über die einzuhaltenden Hygienerichtlinien informiert worden (etwa wie unsere Schutzausrüstung mehrfach zu nutzen ist). Leider ist dies jedoch zum nochmaligen Nachvollziehen nirgends schriftlich hinterlegt worden. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Transparenz, ein guter Informationsfluss und eine authentische Teilnahme und Wertschätzung bei uns derzeit fehlen. Fürsorgepflicht sieht für mich anders aus. Wenn man auf solche Mängel hinweist und sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einsetzt, dann gerät man schnell in den Fokus der Klinikgeschäftsführung. So wurde auf mich persönlich schon Druck ausgeübt.
Was mir gut tut und hilft, ist der hohe Zusammenhalt und die starke Solidarität unter den Teams in unserem Krankenhaus. Zudem erhalte ich viel Hilfe von Freunden, der Familie und der Nachbarschaft und erlebe solidarische Gesten aus der Bevölkerung.
Matthias, 39 Jahre, Krankenpfleger, Helios Amper Klinikum Dachau
Gemeinschaft – auch wenn wir auseinander sind
Ich bin in der Kirchengemeinde ehrenamtlich engagiert. Verteile den Gemeindebrief, helfe beim Gemeindefest, Kirchenkaffee und beteilige mich ab und zu mit Lesungen am Gottesdienst. Ich leite den Seniorenclub Schney mit monatlichen Kaffeetreffen und organisiere drei Fahrten im Jahr. Außerdem beteilige ich mich am Frauenbündnis Lichtenfels. Das liegt jetzt auch lahm. Gut ist, dass es jetzt keine Abendtermine mehr gibt. Aber das Schlimme ist, dass ich die Senioren nicht betreuen kann. Die können nicht zusammenkommen und ich kann nicht alle am Telefon betreuen. Das sind über 40 Leute. Das geht mir schon nach. Ich rufe Einzelne an, die sonst nicht viel Kontakt haben können. Aber dieses soziale Umfeld fehlt mir schon gewaltig.
Es gibt keine Gottesdienste und Gruppentreffen. Die Konfirmation hat nicht stattgefunden. Deshalb haben wir eine Wand in der Kirche gemacht. Dort können Menschen, die die Kirche besuchen, ihr Sorgen und Ängste hinschreiben und hinhängen. Aber auch Sprüche und Positives, was eben Trost spendet. Wir haben sie Klagemauer genannt. Das wird gut angenommen. Es wurde Eier hin gehängt, Blumen und Herzen. Es war ganz unterschiedlich. Die Konfirmand*innen konnten sich dort an der Wand ein Geschenksäckchen abholen. Das haben fast alle gemacht. Wir wollen es solange belassen, wie wir nicht mehr gemeinsam in die Kirche gehen können.
Überraschend war, dass so viele an der Wand mitgemacht haben. Es gibt mir Kraft zu wissen, dass die Kirche offen ist. Und es ist schön, dass andere teilnehmen. Das schafft Gemeinschaft, auch wenn man auseinander ist. Man sieht, es sind Menschen da, denen es genauso geht. In der Frauengruppe schreiben wir uns über Internet und wollen uns im Herbst wieder treffen.
Ruth, 64 Jahre, Ehrenamtliche Treffleiterin
Gummi ist die neue Hefe …
Unser Geschäft ist ein altes Familienunternehmen, aber solche Zeiten hat es auch noch nicht erlebt. Sicher, die Aufgabe eines Kaufmanns ist es, Waren und Märkte zu beobachten, Ware zu besorgen und dorthin zu bringen, wo sie nachgefragt wird. Aber zurzeit dreht sich alles nur um Gummi für Stoffmasken. Über viele Ecken haben wir einige Kilometer Gummi bekommen können, die wurden direkt aus der Maschine einfach in Kartons gelassen und meine Tochter und ich sitzen dann halbe Nächte am Tisch entwirren die, messen 10 Meter-Einheiten ab und verpacken den Gummi in Tüten … nur um am ersten Öffnungstag bereits wieder ausverkauft zu sein.
Demnächst kommt neuer Gummi und mehrere Kilometer Baumwollstoff für Masken, einige nähen auch für Flüchtlingsheime oder zum Weiterverkauf, eigentlich gibt es kaum noch ein anderes Thema. Ganz wenige haben auch Patch-Work Utensilien gekauft, die haben jetzt mehr Zeit für ihr Hobby.
Die Kunden sind verständnisvoll, stehen auch bereitwillig vor dem Laden an, da wir nur jeweils eine Person gleichzeitig einlassen, allerdings muss der Umgang mit den Stoffmasken noch besser geübt werden, da wird Mundschutz manchmal wörtlich genommen, die Nase bleibt frei und Abstand zum Verkaufspersonal bleibt auch ein Thema. Wir hoffen auf eine baldige Normalisierung der Lage. In den Wochen, in denen das Geschäft geschlossen war, haben wir versucht unsere gewerblichen Kunden weiter zu bedienen. Der Zeiteinsatz ist aber stark gestiegen. Unser Tag bräuchte mehr als 24 Stunden. Aber wir sind zufrieden, vor allem die Stammkunden halten uns die Treue und wir sind froh, jetzt wieder Einzelkunden bedienen zu können.
Wolfgang, 58 Jahre, Groß- und Einzelhändler für Kurzwaren
Egal was passiert – wir schaffen es!
Wir haben ein Restaurant für verfeinerte italienische Küche, das mein Mann Leonardo und ich uns in 18 Jahren aufgebaut haben. Zurzeit heißt das: 100 Prozent Kurzarbeit, geschlossen und unsere Mitarbeiter warten schon sehnsüchtig darauf, wieder arbeiten zu dürfen. Schon Ende Februar kamen die Stornierungen von Messebesuchern und als wir im März zumachen mussten, war es für mich die ersten zwei Wochen ganz schlimm. Wir wussten gar nicht, wie es weitergeht. So viel wie in dieser Zeit habe ich in meinem ganzen Leben nicht geheult. Aber mit der Zeit haben wir uns arrangiert. Das mit dem Kurzarbeitergeld läuft zwar schleppend und von der beantragten Soforthilfe haben wir noch gar nichts bekommen aber mit einem kleinen Darlehen der KFW stemmen wir das. Finanziell ist es so angespannt aber machbar. Es muss ja irgendwie weitergehen.
Die Zeit überbrücken wir mit Aufräum- und Umbauarbeiten. Die Terrasse wird hergerichtet, die Lüftung in der Küche überholt und ich bringe mein Büro auf Vordermann. Dazwischen haben wir auch überlegt, das Restaurant „to go“ zu machen – haben uns aber letztlich dagegen entschieden. Da müssten wir viel Plastikverpackungen anschaffen – wo wir sonst versuchen, nachhaltig zu arbeiten: Ohne Plastik und mit hochwertigen Zutaten aus der Region. Unsere Speisen sind auch nicht so geeignet zum Mitnehmen. Bei uns gibt es keine Spaghetti, Pizza oder Lasagne.
In den letzten Wochen hatten mein Mann und ich viel mehr Zeit füreinander. Das ist wunderschön und wir genießen es. Und es gab mehr Zeit für Gespräche mit der Familie und unseren Mitarbeiter*innen. Das hat uns aufgebaut. Wenn man über die Probleme spricht, tun sich neue Sichtweisen und Lösungen auf. Da konnten wir sagen: „Es ist zwar schlimm aber es ist nicht der Untergang“. Gemeinsam haben wir kreative Gedankenspiele gemacht und uns überlegt, ob wir Fingerfood-Gerichte aus Sizilien im Straßenverkauf anbieten. Wir haben tolle Sachen gekocht zum Ausprobieren – das baut einen auf. Dann konnten wir sagen: Egal, was passiert, wir schaffen es.
Während der ganzen Zeit gab es Mails von Gästen, die uns geschrieben haben, dass sie uns vermissen und sich freuen, wenn wir wieder aufmachen. Das hat uns sehr motiviert, weiter zu machen. „Jetzt erst recht“ haben wir uns gedacht. Am 26. Mai machen wir wieder auf und wir haben schon viele Reservierungen. Wir freuen uns drauf und die Gäste auch!
Elisabeth, 70 Jahre, Restaurantbesitzerin
Mit Telefonfensterln gegen die Einsamkeit
Als Altenheimseelsorgerin bei der Diakonie bin ich eine der wenigen im Arbeitsfeld, die als Teil der jeweiligen Gesamtteams noch unverändert in „meine“ Häuser gehen darf. Die Zusammenarbeit mit der Pflege, der Verwaltung und dem Sozialdienst ist toll. Wenn uns gemeinsam etwas einfällt, was die Situation für die Bewohner erträglicher macht. Diese Selbstwirksamkeit motiviert. Unsere Arbeit ist dann nicht nur systemrelevant, sondern auch sinnschöpfend.
Alle Mitarbeitenden tun, was sie können und in Corona-Zeiten tun sie noch mehr und drehen am Rad. Gerade die Einsamkeit der Bewohner ist schlimm. Nicht bei allen und immer, aber Hygienestandards und Kontaktbeschränkungen verstärken die Einsamkeit und zeigen das Dilemma zwischen Lebensschutz und Lebensqualität. Es ist sauanstrengend, aber es ist wichtig, dass Menschen wie wir tatsächlich da sind. Es lindert die Einsamkeit, schafft Momente des Lachens und gibt das Gefühl, nicht von Gott verlassen zu sein. Und das ist schön.
Andererseits: Selbst wenn wir „verschont“ bleiben, ich bin besorgt, wie lange wir das noch so durchhalten können. Bei allem, was wir auf die Beine stellen, bei allem Verständnis und aller Geduld: Unsere Bewohner*innen sind hochaltrig und multimorbid. Die gegenwärtige Isolation halten sie bei der eh schon vorhandenen eingeschränkten Lebensqualität nicht ein Jahr durch. Neben Einzelgesprächen mit Bewohner*innen, Pflege- und Reinigungskräften und Andachten und Hofgottesdiensten, bin ich zurzeit viel beschäftigt mit der Unterstützung und Begleitung von Angehörigenkontakten zu Bewohnern, zum Beispiel unterstütztes „Telefonfensterln“. Viele Angehörige machen sich Sorgen: Wie kann ich die sterbende Mutter begleiten? Wird sie mich in einem halben Jahr überhaupt noch erkennen? Da sind sie froh über den Kontakt durch die Fensterscheibe hindurch.
Das Telefonfensterln geht so: Ich habe Listen und telefoniere Angehörige ab und bastele einen Terminplan. Die Pflege organisiert dann, dass die Bewohnerin auch bereit ist und die Verwaltung checkt, ob es noch Klärungsbedarf mit den Angehörigen gibt. Zum vereinbarten Zeitfenster sorge ich für ein bis zwei aufgeladene Telefone und bringe die Bewohner*in im Erdgeschoss ans Fenster, wo Tochter, Enkel oder Ehepartner schon draußen vor dem Fenster warten. Dann können sie durchs Fenster winken und sich übers Telefon unterhalten, die Angehörigen können aber auch Mitbringsel abgeben. Dann sind alle in der Regel happy, haben Tränen in den Augen und sind dankbar. Das klappt sogar für Demente, was schön ist. Vor lauter Telefonieren habe ich allerdings schon Blumenkohlohren!
Bei unseren Hofgottesdiensten – nach dem Motto: „Ihr da oben, ich hier unten“ – bin ich immer noch weit weg, weil die Leute auf den Balkonen sind und ich im Hof. Die können mich zwar nur schwer sehen, aber gut hören! Mit der neuen Verstärkeranlage können wir jetzt viel mehr machen. Die Anlage ist cool, da kann ich vom Handy sogar Kirchenglocken abspielen und die Orgel anschließen. Beim ersten Hofgottesdienst habe ich vor Freude nur gegrinst, es ist so gut, wieder etwas machen zu können! Mein Job ist besser als Papst, denn wir sehen einander direkt und nicht nur über Kamera und Bildschirm.
Petra, 56 Jahre, Diplom Religionspädagogin, Altenheimseelsorgerin Stadtmission Nürnberg
Der gemeinsame Klang fehlt
Ich habe mehrere Jobs. Ich bin Kirchenmusikerin, nebenher Klavierlehrerin und leite verschiedene Chöre. Am Anfang ist erst mal alles weggefallen. Den Privatunterricht kann man am einfachsten organisieren. Das geht auch online gut. Die Schüler nehmen mir ein Übungsstück auf und schicken es. Sie können es dann machen, wenn es in ihren Zeitplan passt. Viele Menschen aus den Chören sagen, es reicht ihnen, wenn sie den ganzen Tag Video Konferenzen haben. Das ist störanfällig und anstrengender als normaler Unterricht. Beim Kirchenchor funktioniert es auch noch nicht so. Da sind weniger Sänger*innen technisch gut ausgestattet. Es ist außerdem klar, dass auf absehbare Zeit kein Singen in der Kirche möglich sein wird. Das schmerzt und dann fehlt ein Stück weit die Motivation.
Mit meinen gemischten Chören ist mehr möglich. Wir machen keine Chorprobe im üblichen Sinne, sondern Übestunden per Video-Schaltung. Das heißt, ich spiele Übungstracks ein. Das ist ein Video-Tutorial live. Wir können am Anfang miteinander reden, uns einsingen und Lockerungsübungen machen. Dann werden die Mikrofone stumm gestaltet und jede/r übt für sich selber, was ich vorgegeben habe. Ich sehe alle, die mitmachen, aber höre sie nicht. Rückfragen stellen geht trotzdem. Zwischendurch kann ich auch Tutorials aus dem Internet einspielen. Aber man sieht halt nur Mund auf und zu wie bei Fischen im Aquarium. Der gemeinsame Klang und das Atmen fehlen völlig. Diese Klang-Gemeinschaft fehlt mir schon. Aber wenn man vom Vergleichen mit der normalen Situation wegkommt, macht es auch Spaß.
Wir haben Ehemalige angeschrieben, die weggezogen sind. Die können jetzt bei einer Online Probe wieder mit dabei sein, wenn sie Lust haben. Ein paar haben sich gefreut und machen mit. Auch wenn das Video –Treffen nur eine Krücke ist: Wir gehen doch in Interaktion. Und für jede*n einzelnen bedeutet das: ich muss mich klar dafür entscheiden. Es ist anstrengender und teils mit technischen Problemen behaftet, aber es verstärkt das Gemeinschaftsgefühl. Hinterher geht es uns doch besser. Gerade bei den Zoom-Chortreffen muntert man sich gegenseitig auf. Spaß geht auch digital. Da entsteht auch viel Kreativität und wir lachen zusammen. Das ist toll.
Annedore, 48 Jahre, Kirchenmusikerin, Klavierlehrerin, Chorleiterin
Volkshochschule digital?
Meine Arbeit dreht sich seit Anfang März fast ausschließlich um Corona und die Maßnahmen dazu. Seit April haben wir Kurzarbeit – dadurch gibt es fast keinen Kontakt mehr mit den Kolleginnen. Außerdem muss ich viele neue Aufgaben in kürzerer Zeit bewältigen. Wir arbeiten an Online Angeboten: als Ersatz für ausgefallene Kursstunden und auch als zusätzliches Angebot ab dem nächsten Semester, da wir ja momentan gar nicht wissen, wann und in welcher Form unser Programm wieder stattfinden kann. Alternativ versuchen wir jetzt bereits, besondere, bis jetzt noch nicht feststehende, Maßnahmen einzuplanen, beispielsweise gewisse Abstände in den Kursräumen einzuhalten usw.
Es frustriert mich, dass es meine eigentliche Arbeit nicht mehr gibt bzw. nur in geringem Umfang. Außerdem belastet mich die Situation unserer Dozenten*innen; sie haben in der Regel keine betrieblichen Kosten und deswegen keine Ansprüche auf Soforthilfen o.ä. Ich suche ständig nach Möglichkeiten, ihnen irgendwie zu helfen. Viele verdienen sich einen großen Teil ihres Lebensunterhaltes mit den Kurshonoraren. Sorgen macht mir der künftige Umgang mit Risikopatienten*innen. Wir sind davon in der Familie betroffen und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das gelöst werden soll.
Durch die Kurzarbeit bin ich sehr oft daheim und kümmere mich hier um Hausarbeit, Homeschooling unseres Sohnes usw. Das sind eigentlich nicht die Aufgaben, die ich mir wünsche. Mir fehlt der persönliche Kontakt zu unseren Teilnehmer*innen und zu den Kolleg*innen. Außerdem die oft so negativ beurteilte „Alltagsroutine“!
Wir setzen uns mehr mit der Digitalisierung auseinander als wir es bisher getan haben. Das haben wir vor ein paar Monaten noch ganz nach hinten gestellt. Ob das unsere Zukunft ist? Wir glauben noch nicht daran, aber durch die Situation müssen wir uns damit auseinandersetzen.
Ich habe die Hoffnung, dass das alles irgendwann vorbei sein wird, es einen Impfstoff geben wird und wir alle wieder unser „altes“ Leben haben werden mit körperlichem Kontakt, Freude, Lachen, Umarmungen…
Andrea, 54 Jahre, Geschäftsleiterin der Volkshochschule Indersdorfer Kulturkreis
Regenbogen im Küchenfenster
Vielleicht hatte dieses Erlebnis schon mal jemand, der von einem Auto mit Schaltung auf ein Automatikfahrzeug umgestiegen ist und kuppeln wollte. Wenn es gut lief, dann war es einfach der Tritt ins Leere und es war nur eine kurze Verwirrung. Wenn es aber schlecht lief, dann hat man das übergroße Bremspedal erwischt und dieses mit dem Druck, den man sonst für die Kupplung nutzt und das Auto stand von jetzt auf gleich. So ungefähr ging es mir als Studienleiter an der Gemeindeakademie.
Aus voller Fahrt ausgebremst. Schockstarre. Verwirrung. Das war das Gefühl zu Anfang und auch das neue an der Arbeitssituation. Auf der neuen Stelle als Studienleiter bin ich erst seit September 2019, also eigentlich noch in der Einarbeitung direkt vor Ort. Vertraut mit dem System an sich bin ich, da ich vorher über 10 Jahre „nebenamtlich“ bereits Beratungen und Organisationsentwicklung ausgeübt habe.
Glücklicherweise hab ich ein gutes Team und wir haben miteinander einen guten Umgang mit der neuen Situation gefunden und tun dies immer wieder neu. Jetzt nach Ostern gibt es einen gewissen Aufbruch, die Schockstarre lässt nach und wir kommen wieder gemeinsam ins Arbeiten. In neuen Formen, in neuen Zusammenhängen und mit einer stark veränderten Umwelt.
Neben all dem im Hauptamt gibt es noch mein privates Projekt. Mitte März ist mein Buch erschienen, „Gott geht unter die Haut – Glauben aus Leidenschaft“. Viel war geplant. Von einer Lesung mit Musik von Johnny Cash in der JVA, Fernsehauftritte, Radio, Zeitungsinterviews sowie die Buchmesse in Leipzig. Und auch hier… ausgebremst. Buchhandlungen haben zu, Amazon liefert priorisiert „systemrelevantes“ wie Klopapier, Mundschutz und Desinfektionsmittel. Mein Herzensprojekt auf dem Abstellgleis. Aber auch hier gibt es Hoffnung. Hoffnung auf Besserung.
Mit meiner Tochter haben wir einen Regenbogen gemalt, der für die Nachbarn aber auch für uns im Küchenfenster hängt, deutlich sichtbar. Drüber steht: „Alles wird gut!“ Daran glaube ich. Mit Gottes Hilfe.
Rainer, 47 Jahre, Studienleiter und Diakon
Grenzen setzen
Als Angestellte in einem Industriekonzern bin ich das regelmäßige Arbeiten im Homeoffice gewohnt. Die aktuelle Situation ist jedoch alles andere als normal. Denn auch alle anderen Kollegen im Bürobereich arbeiten zu Hause. Das bedeutet, dass keiner auf Dienstreisen oder in gemeinsamen Terminen ist, sondern wirklich jeder vor seinem Rechner sitzt. Und das durchschnittlich 8 Stunden am Tag. Die Leute haben gefühlt mehr Zeit sich detailliert mit Themen zu beschäftigen und gleichzeitig gibt es ein Ungleichgewicht, da der Überblick fehlt und die Auslastung jedes Einzelnen nicht mehr sichtbar ist. Das Gefühl immer und ständig erreichbar sein zu müssen, ist größer denn je. Auch ich ließ mich in diesen Sog ziehen. Schon morgens um 7 Uhr loggte ich mich ein, damit ich noch einen Zugang zum ständig überlasteten Firmennetz bekam. Oftmals ließ ich sogar die Mittagspausen weg, damit ich noch mehr schaffe oder die vielen verpassten Telefonate zurückrufen konnte. In der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe fließen regelmäßig auch nach Feierabend oder am Wochenende Informationen. Mir fehlen der Abstand zum Büro, der tägliche Weg und der persönliche Austausch. Und auch eine klare Abgrenzung von Beruflichem und Privatem. Da hilft nur eines: klare Grenzen für sich selbst setzen. Dieses Umdenken hat bei mir bewirkt, dass ich es nun an den meisten Tagen zum Beispiel genießen kann, mittags auf meiner Terrasse zu sitzen und eine wohlverdiente Pause einzulegen. Und die Whatsapp-Gruppe ist bis auf Weiteres „stumm“ geschaltet.
Eva, 35 Jahre, Führungskräfteentwicklerin bei einem Automobilzulieferer
Kurzarbeit-Beratung am Telefon
Ich bin ehemaliger Betriebsrat und immer noch viel im DGB engagiert. Vor der Kommunalwahl habe ich noch an einigen Aktionen teilgenommen. Wir haben uns für den Sonntagsschutz eingesetzt. Am 15. März war ich noch Wahlhelfer und danach haben viele Firmen im Raum Lichtenfels Kurzarbeit angemeldet. Wir im DGB wurden immer sehr frühzeitig über alles Informiert zum Thema Kurzarbeit aus den Arbeitsagenturen bei uns in der Region. Ich kenne viele Betriebsräte vor Ort und habe dann immer mit die neuesten Infos aus der Arbeitsagentur weitergegeben an die Betriebsräte. Mehrere Stunden am Tag hab ich telefoniert und gemailt. Das war immer nur am frühen Vormittag möglich. Danach sind die Internetleitungen immer zusammengebrochen.
Ich berate auch Menschen am Telefon zur Kurzarbeit. Wir haben niedrige Löhne in Oberfranken und bei 0-Kurzarbeit heißt das für einige um die 780.- Euro im Monat. Die Kollegen kämpfen da grade dafür, dass eine Firma das Kurzarbeitergeld aufstockt. Sonst können die Kollegen Miete und Strom nicht mehr bezahlen. Es gibt auch Menschen, die haben mehrere Minijobs. Die sind nicht Arbeitslosenversichert und werden freigestellt und bekommen nirgends woher Geld. Die müssen dann zum Job-Center und Hartz 4 beantragen. Da wird einem bewusst, was alles in so einer Krise passieren kann. Und es wird klar, es muss hier endlich mal was passieren: Löhne rauf und Menschen mit Minijobs müssen besser abgesichert werden.
Für die Mai-Kundgebung hatten wir viel geplant. Wir haben Informationen über Unternehmen gesammelt und wollten Sketche spielen. Da steckt viel Arbeit dahinter und dann wurde alles abgesagt. Da war ich enttäuscht. Ich organisiere auch Bildungsreisen für den DGB schon über 30 Jahre in ganz Europa. Wir haben für Juni eine Reise nach Korsika geplant. Wir warten zwar noch ab aber wahrscheinlich müssen wir das auch stornieren. Das tut weh, weil sich viele der Kolleg*innen schon gefreut haben.
Für mich persönlich bedeuten die Einschränkungen durch Corona, dass ich einerseits nicht mit meinen Enkeln unternehmen kann. Positiv ist, dass ich zuhause vom Keller bis zum Dachgeschoss alles entrümpeln und den Garten pflegen kann. Jetzt habe ich nicht so viel um die Ohren und der Druck ist weniger. Und da schaut es prima aus im Garten. Und wir haben beim DGB Zeit, einen längeren Artikel für die Zeitung über die Geschichte der Gewerkschaft hier in Oberfranken zu schreiben.
Heinz, 70 Jahre, ehem. BR-Vorsitzender sowie IG-Metall- und DGB – Engagierter
Irgendwie muss es dennoch gehen – während Corona in Hongkong arbeiten
Das chinesische Neujahrsfest Ende Januar und Februar begann ganz unbeschwert. Das sollte aber nicht lange so bleiben. Anfang Februar waren die Supermärkte leer gekauft. Masken gab es keine mehr. Und ich sollte, wie viele andere in Hongkong, 14 Tage in der Isolation in meiner Wohnung bleiben. Das war schwierig und neu. Aber irgendwie habe ich mich eingefunden.
Mittlerweile arbeite ich wieder mit Maske im Büro. Zumindest jede zweite Woche. Wir rotieren aktuell, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Eine Woche arbeiten wir im Büro und dann eine von Zuhause.
Mein Arbeitgeber, eine Bank, ist vorbildlich. Wir bekommen für die Arbeit Masken, Seife, Desinfektionstücher und dürfen per Uber oder mit dem Taxi zur Arbeit fahren. Dennoch fühle ich mich unsicher. Ich habe Angst mich jetzt doch noch anzustecken. Im Büro habe ich Kopfschmerzen wegen der Schutzmasken und weil ich ständig meine Umgebung beachten muss. Auf den Abstand zu Kolleginnen und Kollegen will und muss ich achten. Privat habe ich keine Masken. Sie zu kaufen ist eine Unmöglichkeit.
Aber irgendwie muss es dennoch gehen. Ich muss ja meine Miete zahlen. Ohne Arbeit habe ich kein Einkommen. Ohne Einkommen keine Lebensgrundlage im teuren Hongkong. Aber ich versuche, mich nicht herunterziehen zu lassen. Da muss ich und alle durch! Eine direkte Kraftquelle dafür habe ich nicht. Aber ich habe schon vieles durchgestanden, da stehe ich auch das durch.
Rui, 31 Jahre, Volkswirtin bei einer Bank in Hongkong
Mit dem Sousaphon gegen den Corona-Blues
Besonders ist im Moment mehr oder weniger alles. Seit 1. März bin ich in der Tanzlehrerausbildung. Das lief drei Wochen und dann musste die Tanzschule schließen. Ich übe mit einer Kollegin, die mit mir in einer WG lebt. Wir gehen die Theorie durch. Sie schaut, ob meine Technik passt. Aber der normale Tanzschulbetrieb fällt weg. Da habe ich in den Kursen als Tanzpartner mit einer Tanzlehrerin zusammen vorgetanzt. Also habe ich jetzt schon mehr Zeit. Normalerweise spiele ich bei den jungen Fürther Streichhölzern. Aber Orchester spielen ist jetzt auch nicht möglich. Das vermisse ich sehr.
Ich habe viele Videos aus Italien gesehen habe, wo Musiker auf ihren Balkonen stehen und Musik für die Nachbarschaft spielen. Das fand ich cool. Und ich hab mir gedacht, Marching-Band ist das, was ich mit meinem Instrument (Sousaphon) machen kann. Ich habe meinen Freund angerufen. Der studiert Posaune an der Hochschule für Musik in Würzburg. Wir kennen uns seit der 7ten Klasse und haben an der Schule in Ensembles gespielt, haben Orchester-Erfahrung zusammen. Der hatte auch grade keine Uni und zwei Tage später waren wir das erste Mal zusammen als „Marching-Corona-Band“ in der Nürnberger Südstadt unterwegs.
Am Anfang hatten wir vier Stücke. Dazwischen haben wir geübt und das Repertoire erweitert. Mittlerweile sind es fünfzehn. Wir spielen >Let ist be<, > Hey Jude<, >Probiers mal mit Gemütlichkeit< oder >Always look on the bride side of life<. Im Laufen ist das spielen schwieriger. Man muss ja aufpassen, wo man hinläuft. Deshalb müssen die Lieder einfacher sein. Musik ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Und ich bin froh, dass ich das für mich und meine Mitmenschen so positiv nutzen kann. Ansonsten würde ich hier echt eingehen. So hab ich meine Musik trotzdem.
Lorenz, 19 Jahre, Tanzlehrer-Azubi und Musiker
„Wenn ich untergehe, bevor das Geld kommt, nützt die Soforthilfe nicht mehr viel.“
Die Krise trifft uns als Familienbetrieb hart. Es kommen zu wenig Kunden. Unsere beiden Geschäfte liegen hier in einer Gegend mit vielen Ämtern und Büros – die sind nun alle im Homeoffice. Auch die Sprachenschule in unserem Haus ist zu, da kamen immer viele Teilnehmer zum Mittagsessen zu uns. Auch Touristen gehörten zu unserer Kundschaft. Das alles fehlt uns jetzt.
Zwei Wochen lang mussten wir ganz schließen, denn es hat einfach nichts mehr gebracht. Wir mussten viele Lebensmittel zur Caritas bringen, bevor sie verderben. In dieser Zeit haben wir uns gesagt, wir ruhen uns einmal richtig aus, stärken das Immunsystem. Wir machen sonst sehr wenig Urlaub im Jahr. Ein Vorteil in diesen zwei Wochen war, dass wir alle Zuhause waren, auch unsere beiden Kinder. Dass wir morgens zusammen frühstücken und auch abends alle zusammen essen, kam vor Corona nur drei-, viermal im Monat vor. Das hat unserer Familie jetzt mal gutgetan.
Mein Mann und ich haben für beide Geschäfte direkt am Anfang der Krise Soforthilfen beantragt. Für das Lebensmittelgeschäft haben wir 5.000 Euro bekommen, für die Bäckerei aber noch nichts. Danach haben wir gehört, dass die Soforthilfe auf 9.000 Euro gestiegen ist. Auch das haben wir beantragt, warten aber noch auf eine Antwort. Mit der Soforthilfe kommst du allerdings sowieso nur einen Monat über die Runden. Ich musste schon von meinem privaten Geld Einlagen machen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Unterstützung in Deutschland besser. Aber es müsste schneller gehen. Wenn ich untergehe, bevor das Geld kommt, dann nützt mir die staatliche Soforthilfe nicht mehr viel. Auch Kurzarbeitergeld für unsere Beschäftigten haben wir noch nicht bekommen.
Wer hätte gedacht, dass wir mal so eine Krise erleben? Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, habe nie Krieg, Armut oder etwas Ähnliches erlebt. Jetzt gibt es Phasen, wo ich wirklich Angst bekomme. Mit der Bäckerei halte ich das bestimmt nicht sehr lange aus. Höchstens drei bis vier Monate. Hier im Lebensmittelmarkt könnte ich länger durchhalten, denn die Miete ist hier niedriger. Aber insgesamt bin ich noch optimistisch und denke: Wir kommen da schon heil wieder raus.
Nermin, 44 Jahre, Besitzerin eines Lebensmittelgeschäfts mit Imbiss sowie einer Bäckerei
Freue mich auf die Zeit nach Corona…
Vor rund einem Jahr erst hatte ich meinen neuen Job in der Europa-Geschäftsführung eines großen amerikanischen Konzerns angetreten. In vielen Stunden und unzähligen Besprechungen hatten wir mit einem tollen Team eine neue Strategie auf den Weg gebracht, die uns nach jahrelangen Verlusten endlich wieder in die Gewinnzone führen sollte. Und die Maßnahmen zeigten erste Wirkung. Die Verkaufszahlen stiegen, die Kosten sanken und die Ergebnisse wurden langsam besser. Man konnte förmlich spüren, wie wir so etwas wie ‚Momentum‘ bekamen und die Dinge sich zum Guten zu wenden schienen.
Dann traf uns Corona mit voller Wucht. Durch die Ausgangsbeschränkungen und die Schließung all unserer Filialen brachen die Umsätze innerhalb kürzester Zeit fast vollständig ein. Was blieb waren die monatlichen Fixkosten in dreistelliger Millionenhöhe.
Wirtschaftlich ist das offensichtlich nicht lange durchzuhalten und so mussten wir innerhalb kürzester Zeit voll in den Krisenmodus schalten. Und das musste von zu Hause aus geschehen, um das gesundheitliche Risiko für uns und unsere Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Digitale Tools und Videokonferenzen waren bei uns schon lange vor der Krise weitgehend etabliert. Aber dass das so schnell unser einziges Kommunikationsmittel sein würde, damit hatte niemand gerechnet.
Auch vor der Krise hatte ich schon oft länger gearbeitet, aber so müde wie aktuell war ich am Abend selten. Zwischen den virtuellen Meetings gibt es leider keine Pausen. Der kurze Austausch an der Kaffeemaschine, der Fussweg von einem Meetingraum in den nächsten oder der Kantinenbesuch mit Kollegen entfällt einfach. Stattdessen sitze ich 12-14 Stunden am Tag auf meinem Stuhl in meiner Wohnung vor dem Bildschirm. Auf Dauer finde ich das wahnsinnig anstrengend und auch persönlich wenig bereichernd. Der informelle Austausch mit den Kollegen auch über die Arbeit hinaus fehlt mir einfach.
Nach Regen kommt aber hoffentlich auch wieder Sonnenschein. Und so freue ich mich darauf, baldmöglichst wieder vor Ort an der hoffentlich erfolgreichen Zukunft unseres Unternehmens zu arbeiten.
Christian, 38 Jahre, Mitglied der Geschäftsleitung
Trommeln über Skype
Ich bin freischaffende Musikerin, gebe Schlagzeug Unterricht, spiele in Bands, gebe Workshops als Dozentin und arbeite auch als DJ. Durch Corona haben sich meine Tätigkeiten von einer 60 Stunden Woche auf eine 15 Stunden Woche reduziert. Alle Auftritte als Musikerin, alle Workshops und Seminare als Workshop Dozentin und Motivationstrainerin sind bis Ende August abgesagt und keiner weiß, wie es danach weitergeht und vor allem wann es weitergehen darf.
In den ersten zwei Wochen nach der Ausgangsbeschränkung war ich wie in Schockstarre. Nun konnte ich aber einige meiner Schüler dazu überzeugen, Unterricht per Skype zu nehmen und das klappt auch sehr gut. Jüngere Schüler kann ich leider nicht online unterrichten und ältere Schüler haben oft die technische Ausstattung nicht verfügbar.
Es fehlt mir der persönliche Kontakt zu meinen Schülern und vor allem meine Arbeit als Musikerin, die die Menschen auf der Bühne unterhält und glücklich macht. Der positive Aspekt liegt darin, dass ich jetzt Zeit habe, an meinem Lehrbuch für Schlagzeug und Percussion weiterzuarbeiten und natürlich viele liegengebliebene Arbeiten, wie z.B. Buchhaltung, erledigen kann.
Der neue Zusammenhalt, den ich gerade in meinem Freundeskreis und im Umfeld meiner Musikerkolleginnen und Kollegen finde, gibt mir Kraft. Ich freue mich, wenn sich die Lage wieder entschärft und ich vor allem wieder mit meiner Band auftreten darf und meine Schüler zum Unterricht zu mir in mein Musikstudio kommen dürfen!
Karin Anna, freischaffende Musikerin, Dozentin, DJ, Schlagzeug – Lehrerin
Trotz Absagen: Zusammenhalt wird groß geschrieben
Seit Jahresanfang hat sich für uns einiges geändert! Zweck von Messen und Kongressen bzw. Veranstaltungen überhaupt ist die Begegnung und der persönliche Austausch. Durch das Versammlungsverbot haben wir Veranstaltungen bis Juli 2020 abgesagt. Das wären bisher sechs Großveranstaltungen bundesweit mit Besuchern zwischen 1.000 und 6.000 Personen.
Bei Vorbereitungszeiten von teils bis zu eineinhalb Jahre ist es sehr niederschmetternd und enttäuschend, wenn eine Veranstaltung abgesagt werden muss. Alle abgesagten Projekte werden mit viel Leidenschaft geplant. Eine Absage durch unvorhersehbare Umstände ist dann alles andere als motivierend. Die Verlegung auf einen anderen Termin macht meist keinen Sinn. Das hat teils wirtschaftliche, aber oft terminliche Gründe. Das Veranstaltungsjahr ist eng getaktet. Auch im Hinblick auf branchen- oder thematisch ähnliche Veranstaltungen.
An einer Absage hängen aber nicht nur wir! In vielen Bereichen arbeiten wir eng mit teils langjährigen Vertragspartner wie Messe- und Veranstaltungshäusern, Messebauunternehmen, der lokalen Hotellerie und Gastronomie, Cateringunternehmen oder diversen anderen Dienstleistern und Zulieferern zusammen. All das fällt weg. Insgesamt ist ein ganzer Branchenzweig betroffen. Natürlich gibt es technische Möglichkeiten, ausgefallene Veranstaltungen digital als Videokonferenz oder Ähnliches stattfinden zu lassen. Das ist aber meist mit viel Aufwand und Kosten verbunden, die so schnell nicht zu stemmen sind.
Seit den Absagen haben auch wir unsere Arbeitsbedingungen angepasst. Wir haben ein Zwei-Schichtsystem eingeführt, um weniger Kontakt zu Kollegen zu habe. Wöchentlich wechselnd arbeitet ein Teil von uns im Home Office, und Meetings wurden gecancelt. Der Situation geschuldet hat sich der persönliche Austausch deutlich reduziert. Vieles läuft jetzt verstärkt über E-Mail oder Anrufe. Die Arbeit im Home Office ist für mich persönlich – bis auf die räumliche Umstellung – keine große Veränderung. Es macht für mich theoretisch keinen Unterschied, von wo aus ich arbeite. Der einzige Einschnitt ist eben der reduzierte persönliche Kontakt – im beruflichen und privaten Umfeld.
Unsere Kunden und Partner habe Verständnis und Geduld. Das motiviert mich. Mit umso mehr Vorfreude arbeiten wir dann gemeinsam auf das Folgeprojekt hin. Die offene Kommunikation von Seiten unserer Partner aber auch intern hat mich durchaus positiv überrascht. Zusammenhalt wird bei uns großgeschrieben, und situationsbedingt hilft man sich gegenseitig noch mehr aus als üblich.
Christian, 26 Jahre, Stellv. Teamleiter bei Messe- und Kongressveranstalter
„Die Stimmung im Hospiz ist ganz angespannt…“
… zwischen den Gästen und uns und den Besucher*innen. Manche Gäste geben auch gerade auf und denken „O Gott, was soll ich denn da jetzt noch machen, ich will einfach die Nähe“. Sie fordern diese Nähe und sind sehr anhänglich im Moment, weil sie auch weniger Besuch haben. Es darf nur jeweils ein*e Besucher*in pro Gast auf Station sein. Wir sind ja auch 4-5 Pflegende und dann auch die 14 Gäste, da sind genug auf Station.
Wir haben selbst genähte Mundschutze, die wir nach der Arbeit heiß bügeln sollen. Für den Fall, dass jemand von uns Corona-positiv getestet wurde, ist Schutzkleidung vorhanden. Manche der Gäste haben Angst, eine Corona-Infektion zu bekommen. Für einige ist es schwierig, wenn wir Mundschutz aufhaben. Hauptsächlich für die, die verwirrt sind. Das verstehen sie nicht, wo die Stimme herkommt, wenn sie meine Mimik nicht sehen können. Ich gehe auch erst mal ohne Mundschutz rein ins Zimmer, solange ich weit genug weg bin, damit sie mich erkennen, dann mache ich den Mundschutz erst drauf.
Wenn ich die Gäste pflege, habe ich halt auch Körperkontakt, dann greifen sie voll zu, weil sie die Nähe suchen. Das ist im Moment sehr schwierig. Die sind einfach hilflos. Wir haben sonst eine sehr herzliche, körperbetonte Pflege. Bei uns nimmt sonst jeder jeden in den Arm. Das ist nicht mehr da. Ich habe keine Angst, von den Gästen angesteckt zu werden. Woher sollen sie es denn haben. Ich habe Angst, dass ich sie anstecken könnte. Bei uns wird niemand getestet. Vielen geht es so schlecht, dass sie nicht mehr aus den Zimmern kommen. Was auch brutal ist: wenn die Leute gestorben sind, gibt es im Moment keine gemeinsame Zeit für Gespräche und Verabschiedung im Zimmer mehr. Die Angehörigen dürfen nur noch einzeln rein.
Wir sind viel am Telefon für Auskünfte oder müssen an die Tür gehen, weil die nicht mehr offen ist. Das ist auch ein Störfaktor. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen dürfen auch nicht mehr kommen, rufen aber häufig an, weil sie mit „ihren“ Gästen verbunden sind. Viele Gäste können nicht mehr selbst telefonieren, weil sie zu schwach sind, da müssen wir helfen oder selbst Auskunft geben. Davon ist der Arbeitsablauf und die Arbeit an den Gästen auch gestört.
Auf Station ist es wesentlich ruhiger. Kaum jemand hält sich in der Küche auf. Wir trinken nicht mehr zusammen Kaffee. Dafür gehen wir jetzt viel mehr zu den Leuten rein, damit sie nicht alleine sind, nicht alleine essen müssen. Trotzdem ist unter uns Kolleg*innen eine gute Stimmung. Das läuft wunderbar.
Inka, 57 Jahre, Krankenschwester im Hospiz
Zwischen Projektleitung und Trotzphase
Freilich, es ist entspannend, jeden Morgen durch leere Straßen zur Arbeit zu radeln. Nur ist da dieses ungute Gefühl: Wie lang geht das jetzt noch so? Müsste ich wegen der Ansteckungsgefahr darauf drängen, dass wir im Büro endlich einen VPN-fähigen Router einrichten, damit wir datenschutzkonform von Zuhause aus auf unsere Projektdaten und den Server zugreifen können? Und wie wird es dann sein, vom provisorisch eingerichteten Arbeitszimmer aus zu arbeiten, so dass ich nur noch zwischen Keller, Küche und Kind hin- und herpendele?
Ich arbeite als Projektleiter. Die Tätigkeit beinhaltet viel Kontaktpflege mit Auftraggebern, Koordination im Team und die übliche bürointerne Abstimmung. Anfangs war ich ziemlich froh, raus zu „müssen“ – wegen der Bewegung und der Möglichkeit, einen Tag am Stück zu arbeiten. Inzwischen hat sich mit meiner Frau aber eine Vormittag-Nachmittag-Aufteilung eingestellt, die mir rechnerisch noch vier Arbeitsstunden im Büro zugesteht. Das macht vier Minusstunden, täglich.
Und auch die effektive Arbeitszeit bröckelt in dieser Situation schnell weg. Warum ist das so? Naja, wir haben ein zweieinhalbjähriges Kind. Nur eines zwar und freilich zuckersüß, aber in der Trotzphase und mit dem aktuell sehr deutlichen Hang, ein Parade-Einzelkind zu werden.
Meine Frau und ich sind eigentlich aufgrund unserer Berufe auf die KiTa angewiesen. Der Zwerg hatte vor Corona eine 40-Stundenwoche in der Kinderbetreuung. Aber jetzt kommt die Arbeit zwangsläufig und dazu mit einer historisch einmaligen Ausrede regelmäßig zu kurz. Corona beschert uns somit ein bislang für unmöglich gehaltenes Familienleben. Und, ja, darüber freue ich mich ehrlich gesagt sehr.
Bedrückend ist dagegen die große Verunsicherung um Covid-19. Die wesentlichen Fragen lassen sich mit dem aktuellen Stand der Forschung halt einfach noch nicht beantworten. Das auszuhalten ist eine der großen Herausforderungen, seelisch wie psychisch. Jedem möchte ich ersparen, wie unser Freund – ein gestandenes Mannsbild – mit Tränen in den Augen auf der Intensivstation nach Luft zu japsen. Er wurde Gott sei Dank inzwischen geheilt entlassen.
Es bleibt die Hoffnung, dass wir das Virus in einer nur ganz leichten Ausprägung bekommen oder vielleicht unbemerkt schon hatten. Und die Großeltern auch und überhaupt jeder. Damit das alles bald vorbei ist. So schnell wie möglich.
Thomas, 44 Jahre, Landschaftsarchitekt bdla
Eine große Ruhe und Entspannung
Mit dem Anruf einer Freundin und ihrer Nachfrage, ob auch bei uns alle Gottesdienste abgesagt seien, begann für mich die neue Zeit, die „Corona-Zeit“. Zunächst konnte ich mir nicht vorstellen, dass alles ausfällt, was meine berufliche Tätigkeit ausmacht: Altenheimgottesdienste, ökumenische Alltagsexerzitien, Besuche, Wortgottesdienste in der Filialgemeinde, ökumenische Trauergruppe.
Mit der Dienstbesprechung am 17. März wurde mir klar, was es bedeutet, nicht einfach mit den Menschen in Kontakt treten zu können, Trauerfeiern und Beisetzungen nur außen im kleinsten Kreis zu gestalten.
Gleichzeitig stellte sich zunehmend bei meinem Mann, der nach einer Woche im Home-Office in Kurzarbeit ging, und bei mir eine große Ruhe und Entspannung ein. Der Tagesablauf hat sich verändert. Jeden Tag viel mehr Zeit miteinander verbringen zu können, tut uns gut. Gemeinsame Mahlzeiten, auch am Mittag, ruhiger Schlaf und Zeit für Arbeiten daheim, sind wunderbar.
Uns ist sehr bewusst, dass wir in einer herausgehobenen Position sind. Wir fühlen uns nicht in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, da wir in unserer Kindheit Ähnliches erlebt haben. Meine Mutter hat immer wieder gesagt: „Bleibt daheim!“ Sie konnte nie verstehen, dass die Zeit mit so vielen Terminen verplant ist.
Ich arbeite jeden Tag einige Stunden im Büro mit Telefonkontakten, Vorbereitungen für übertragbare Altenheimgottesdienste und Urnenbeisetzungen. Die vielen Informationen zu Corona und den notwendigen Verhaltensweisen sind für mich teilweise anstrengend. Zunehmend spüre ich, dass mir besonders die direkte Begegnung mit den Menschen im Altenheim fehlt und wie schwer es für sie ist, dass Besuche von Angehörigen unmöglich sind, dass die Mitarbeitenden umso mehr gefordert sind.
Kraft schöpfe ich aus der Osterbotschaft: Jesus Christus schenkt neues Leben. Er geht an unserer Seite. Er führt aus dem Dunkel ins Licht.
Elisabeth, 62 Jahre, Seelsorgerin (kath. Gemeindereferentin)
Bücher-Botin-Barbara
Unsere Buchhandlung hat geschlossen. Um uns nicht zu nahe zu kommen, haben wir uns über die Räume verteilt. Wir benutzen die Auslagetische, auf denen sonst Neuerscheinungen liegen, als Arbeitstische, denn unsere Arbeitsabläufe haben sich stark verändert. Die Kunden bestellen jetzt über unsere Website, per Mail oder Telefon. Wir hatten eine Zeitungsanzeige und viele Kunden über unseren Mailverteiler bzw. über Facebook informiert, dadurch hat das Geschäft rasant angezogen. Wir liefern die Bücher jetzt aus oder versenden sie. Vieles muss verpackt werden und es müssen unendlich viele Rechnungen geschrieben werden – auch mal nur für ein einzelnes Reclam Heft. Der Aufwand ist viel größer als sonst. Die Großhändler liefern nicht mehr an allen Tagen und ihre Fehlerquote ist jetzt auch größer. Viele Sachen sind auch nicht lieferbar, z. B. Material zur pädagogischen Kinderbeschäftigung. Da suchen wir für die Kunden dann nach Alternativen.
Wir liefern selber mit Auto und Rad. Ich mache die Touren in der Stadt mit unserem Lieferfahrrad und das kommt super an, ist ja auch klimafreundlich. Unterwegs, wenn mich die Leute sehen, geht oft der Daumen hoch. 30 bis 40 Kunden erreiche ich auf diesem Weg am Tag, außerdem fahre ich auch Bücher zur Post.
Ich finde das mit dem Rad ganz toll. Frische Luft, sich bewegen und das bei herrlichem Wetter. Jetzt kenne ich mich sehr gut aus im Ort, der nicht mein Wohnort ist. Ich lerne Abkürzungen und Schleichwege kennen und Straßennamen, die ich bisher nur aus der Adresskartei kannte, füllen sich mit einer Vorstellung. Ich sehe auch, wie die Kunden leben. Die Arbeit und gerade das Ausliefern lenkt mich ab von der Krise und gibt mir eine konkrete Aufgabe. Es ist schön zu sehen, was man erledigt hat.
Trotzdem fehlt mir der persönliche Kontakt zu den Kunden im Geschäft sehr, besonders zu unseren vielen Stammkunden, die regelmäßig kommen. Das Schöne an meinem Beruf sind ja die vielen interessanten und oft auch tiefgehenden Gespräche, die wir führen, um einen passenden Titel z. B. für ein Geschenk zu finden. Das kann der kurze Kontakt an der Haustür nicht ersetzen. Immerhin – wenn jetzt am Telefon jemand sagt „Sie suchen schon das Richtige aus“ freue ich mich über das Vertrauen in unsere Kompetenz. Meine Kolleginnen fehlen mir auch, durch die Kurzarbeit sehen wir uns viel seltener.
Es macht mich zuversichtlich zu sehen: Wir können erst mal weiterarbeiten, der Laden kann voraussichtlich weiter bestehen. Die Kunden tun viel, um uns zu unterstützen und geben uns tolle Rückmeldungen. Das motiviert mich enorm. Altdorf ist ein besonderer Ort, sehr viele Leute kennen sich untereinander und kümmern sich umeinander. Das gibt Kraft und ich habe das Gefühl, wir vom Laden gehören zu dieser Stadtgemeinschaft dazu. Das merken wir jetzt besonders.
Barbara, 53 Jahre, Buchhändlerin
Videogespräch kann persönlichen Kontakt nicht ersetzen
Ich pflege meinen Mann bei uns Zuhause. Ich bin froh und dankbar, dass dies noch möglich ist. Das ist nur leistbar, da sich meine Kinder aktiv an der Pflege beteiligen. Die Corona-Pandemie hat bisher wenig am Pflegealltag selbst verändert. Die Pflege und ihre Herausforderungen sind gleichgeblieben. Nur der Physiotherapeut kommt nicht mehr. Er und seine Kolleginnen und Kollegen besuchen keine älteren Menschen mehr, da die Ansteckungsgefahr für die zu Therapierenden zu groß sei. Ebenso gibt es keine Besuche mehr für meinen Mann und mich. Nur noch der engste Familienkreis kommt.
Damit gehen mir auch Sozialkontakte verloren. Mir fehlt der Kontakt zu anderen unheimlich, beispielsweise zu meiner Schwester oder Nachbarin und Freundin. Das verunmöglicht mir kleine Auszeiten, die ich sonst gerne genommen habe. Diese Kontakte haben mir immer wieder Kraft für die Pflege von meinem Mann gegeben. Telefon-, Videogespräche oder soziale Medien können das einfach nicht ersetzen. Natürlich freut mich ein Videogespräch mit meiner zweijährigen Enkelin. Aber es ist einfach nicht das gleiche, wie von ihr in den Arm genommen oder geküsst zu werden.
Auch das Einkaufen hat sich vollkommen verändert. Es ist schwierig, immer den Abstand zu halten, weil mache einfach keine Rücksicht nehmen. Ich will mich nicht anstecken, um die Krankheit nicht an meinen Mann weiterzugeben, der zur Risikogruppe gehört.
Daneben empfinde ich es auch sehr belastend, dass nicht mal schnell jemand aus dem Bekannten- und Verwandtenbereich oder auch Nachbarn zu Hilfe rufen kann. Das war zwar auch in der Vergangenheit sehr selten der Fall. Aber nur die Abwesenheit dieser Möglichkeit empfinde ich als sehr belastend. Kraft gibt mir das Wissen, dass meine eigenen Kinder mich unterstützen. Aktuell dürfen sie ja auch noch zur Unterstützung kommen. Das entlastet und spendet Kraft.
Elke, 62 Jahre, Zuhause Pflegende
Raum für Neues
Ich bin pastoraler Mitarbeiter im Erzbistum Bamberg. Alle Gottesdienste und Veranstaltungen, Vorbereitungstreffen und Konferenzen sind ausgesetzt. Dadurch ist viel weniger zu tun. Das ist eine wohltuende Veränderung. Veränderungen tun gut! Immer und zu jeder Zeit. Wie beim Ausmisten zu Hause, schafft die freie Zeit Raum für Neues. Es kristallisiert sich heraus, was wirklich wichtig ist.
Mein Dienstvorgesetzter hat schon früh, soweit es ging, Homeoffice angeordnet. Das dient dem Schutz von uns selbst, unserem Team, aber auch derer, die trotzdem ins Pfarrbüro kamen, solange das gesetzlich noch erlaubt war. Nun sind alle Pfarrbüros für den Parteiverkehr geschlossen. Wir sind nur noch über Telefon oder Mail erreichbar.
Mir fehlen das Büro, das regelmäßige, konzentrierte Arbeiten und die Kommunikation mit Menschen. Mir fehlt die Begegnung von Angesicht zu Angesicht, aber auch allgemein der Kontakt via Telefon oder Mail. Kaum noch jemand ruft an oder schreibt uns eine E-Mail.
Es bleibt Zeit für Liegengebliebenes, wie z.B. die Ablage. Ich bin dennoch etwa zehn Stunden pro Woche im Büro. Ich räume auf, sortiere aus, hefte ab, gliedere Regale neu. Zudem erstelle ich für den gesamten Seelsorgebereich einen täglichen Impuls, den es ansonsten nicht gäbe.
Kraft gibt mir der tägliche Gottesdienst im Livestream und das Bedürfnis, den Menschen dennoch etwas zu ihrem geistlichen Leben zu geben. Auch ohne Gottesdienste hat unser Glaube so viel zu bieten. Zwar ist die katholische Eucharistiefeier Quelle und Ziel unseres Glaubenslebens, aber dieses Leben voller Glauben hat doch so viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Diese lernen wir jetzt kennen und schmücken sie aus.
Alois, 46 Jahre, pastoraler Mitarbeiter Katholische Kirche
Stille im Kindergarten
Wir sind Erzieherinnen in einem kirchlichen Kindergarten. Von heute auf morgen ohne Kinder. Stille im Haus, wo ist das Lachen, Toben, die Fragen der Kinder? Seit nun fast drei Wochen sind wir am aufräumen, putzen und entrümpeln. Alles Arbeiten, die über Jahre liegen geblieben sind. Jeden Tag konnten wir die Ergebnisse unserer Arbeit sehen. Jetzt geht es ans Entwicklungsbögen schreiben, Konzepte verbessern und Portfolios ergänzen. Diese Arbeiten sind im Home-Office nicht zu erledigen.
Wir freuen uns wieder auf die Zeit mit den Kindern. Wir vermissen ihre fröhliche ausgelassene Art.
Kindergarten-Team bei Freiburg, 35 Kinder, zwei Gruppen
Mir qualmen die Ohren von Telefonkonferenzen
Ich bin seit Mitte März zuhause im Homeoffice. Ab und an musste ich mal ins Büro, um was zu holen oder umzuräumen. Ansonsten bin ich als Betriebsrätin immer am Arbeiten. Es ist nicht Meins von zuhause aus zu arbeiten, da ich lieber durch die Büros husche, um zu sehen wie es den Kollegen geht. Aber leider muss ich meinen eigenen Wunsch zurückstellen. Ich habe es mir aber nicht nehmen lassen diese Woche, als ich in der Arbeit war trotz Corona die Großraumbüros abzuklappern. Es war sehr ruhig und ganz wenig Kollegen und Kolleginnen sind noch da. Die Meisten sind zuhause.
Jeder konnte seinen PC und das Equipment mit nach Hause nehmen. Wer es alleine nicht schaffte, bekam Unterstützung vom Teamleiter. Auch das Anschließen zuhause wurde unterstützt. Und mit großen Sicherheitsabstand. Wenn man keine Internetverbindung hatte, bekam man einen Internet-Stick mit dazu ausgehändigt. Daher gibt es keine Quarantäne, sondern Homeoffice. Mein Unternehmen ist weltweit vernetzt. Wir haben seit Mitte März über 60 Prozent der Mitarbeitenden weltweit ins Homeoffice gebracht.
Die Kollegen werden wöchentlich und manchmal täglich in Telefonmeetings zusammengebracht von Ihren Vorgesetzen. Man tauscht sich aus und führt sozusagen einen kleinen bis mittleren Plausch. Dabei geht es nicht um die Arbeit, sondern um die neue Umgebung und das Wohlbefinden. Obwohl es die eigene Wohnung ist. Und wenn es dann sehr persönlich wird, verabredet man sich zu einer separaten Telko.
Ich selbst bin auch in sehr vielen Telefonkonferenzen und manchmal qualmen mir die Ohren bzw. der Kopf. Aber eins habe ich festgestellt bei den weltweiten Telefonkonferenzen: Das Toilettenpapier-Problem ist auch in Frankreich, Italien, Spanien, England, Norwegen und Malaysia ein Thema.
Susanne, 54 Jahre, Betriebsrätin, Telefon-Marketing
1 Mensch. 2 Teilzeitjobs. 3 Selbständigkeiten.
Ich bin IT-Ausbilder für Fachinformatiker, Projektmanager für Augmented- & Virtual Reality, selbständiger Social Media Berater, Klinikclown Rucki und Wellness- & Massagetherapeut in einer Person. So richtig merke ich die Veränderung, wenn es um die Außenkontakte geht. Alle Selbständigkeiten ruhen mittlerweile bis auf kleinere Ausnahmen. Massagen mit direktem Körperkontakt sind natürlich nicht möglich, Besuche in Altenheimen auch nicht. Der Großteil meines Tages besteht aus Telefon- & Videokonferenzen. Jede noch so kurze Abstimmung wird terminiert. Das ist immer das gleiche Vorgehen: Termin einstellen, Einladung zur Videokonferenz, Treffen, Besprechen, Abgleichen, Mails und Aufgaben erledigen und es geht von vorne los. Alles ist sehr stark durch getaktet. Bei meinen beiden Arbeitgebern kann und darf ich von überall aus arbeiten und darf meine Arbeitszeit frei gestalten. Homeoffice ist somit nichts Neues. Nur eben nicht so lange am Stück. Jetzt ist es schon zur Gewohnheit geworden.
Ich erlebe das alles sehr entspannt. Durch meine vielen beruflichen Standbeine bin ich finanziell bzw. existenziell nicht gefährdet. Ich bin gewohnt, dass immer mal das ein oder andere nicht sauber läuft. Ich finde diese Zeit gerade sehr spannend. Jede Veränderung ist immer eine Chance. Genüsslich scheitern und Neugierde auf alles was kommt. Viele Menschen werden kreativ und finden neue Möglichkeiten.
Im Herzen weh tut mir der Wegfall der Clownvisiten und meiner Massagen. Diese beiden Tätigkeiten führe ich aus, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dafür zu sorgen, dass sich Menschen wohlfühlen. Das fehlt mir sehr. Diese Arbeiten von Herz zu Herz. Aber: Meine Clownpartnerin und ich haben es letzte Woche geschafft, zumindest vom Garten aus für 30min ein paar Späße & Lieder für die Bewohner auf den Balkonen zum Besten zu geben. Es ist nicht das Gleiche. Aber: Man sollte immer das Beste aus der Situation machen.
Ich bin positiv überrascht, wie schnell plötzlich neue Home–Office Lösungen gefunden werden. Das freut mich persönlich sehr. In schlechten Zeiten erkennt man wahre Freunde, wahre Gesichter, tolle Arbeitgeber, das was wirklich wichtig ist. Kraft gibt mir in dieser Zeit, zwei herausragende & zuverlässige Arbeitgeber zu haben. Mir wurde sogar von einem Arbeitgeber angeboten, dass ich meine Teilzeit erhöhen könnte, wenn ich den Wegfall meiner Einnahmen der Selbständigkeiten kompensieren möchte. Meine Auszubildenden, die völlig selbstverständlich noch mehr Eigenverantwortung bzgl. Remote-Lernen & -Arbeiten übernommen haben, sind ebenfalls eine Kraftquelle.
Benjamin, 31 Jahre, Macher.Mentor.Mensch. Lieblingsgedicht: „Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit.“
Vom Bett direkt auf den Bürostuhl
Ich telefoniere ja den ganzen Tag – aber jetzt halt zuhause statt im Büro. Ich sitze daheim im Wohnzimmer am Esstisch. Die Firma hat mir einen neuen Computer angeliefert, der wurde im Zimmer aufgestellt. Rechner mit Monitor, Tastatur und Headset. Das hab ich dann nach Anleitung zusammen gebaut. War nicht schlimm, das macht mir eigentlich Spaß. Am Anfang gab es Schwierigkeiten mit der Technik. Die Leitungen waren überlastet. Die ersten Tage hat immer wieder was anderes gewackelt. Aber unsere Teamleiter und der Technik Support sind immer erreichbar und sorgen schnell für Hilfe. Ich finde es toll, dass ich weiter arbeiten kann zuhause und nicht befürchten muss, dass ich kein Geld mehr bekomme.
Ich spreche mit Menschen, die Schulden haben und da kriege ich viele Anrufe, von Leuten, dass sie ihre Kreditraten nicht bezahlen können, weil sie Kurzarbeit haben oder ihr Geschäft schließen mussten, oder weil sie gekündigt wurden jetzt in der Corona Krise. Bis die ganzen Anträge auf Arbeitslosengeld oder Kurzarbeit bewilligt werden, das dauert. In der Situation sind wir angewiesen von oben, dass wir Forderungen stunden oder vorübergehend niedrigere Raten anbieten.
Jetzt geh ich quasi vom Bett direkt auf den Bürostuhl. Das ist komisch. Was mir fehlt ist die frische Luft auf dem Weg in die Arbeit. Da wird man besser wach. Ich lass jetzt morgens immer lange frische Luft durch die Wohnung ziehen. Das tut richtig gut. Angenehm ist es aber schon, dass man nach Feierabend sofort zuhause ist. Da habe ich mehr Freizeit und ich kann morgens eine halbe Stunde später aufstehen. Arbeit zuhause ist anstrengender als im Büro. Hier ist es so still. Im Büro spricht man kurz mit Kollegen. Das fehlt mir, der Austausch mit Kollegen. Dass man „guten Morgen“ sagt und „Schönes Wochenende“. Wir haben einen Chat eingerichtet, wo wir uns morgens treffen und begrüßen. Mittags haben wir eine Videokonferenz zusammen mit den Chefs, da tauschen wir uns aus, können Fragen stellen. Wir kriegen viel Zuspruch von den Teamleitern. Die loben uns und wünschen uns gute Gesundheit. Keiner von den Kollegen mault jetzt rum. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Dieser Zusammenhalt und die Anerkennung – das gibt mir Kraft. Ich habe vorher zehn Jahre in der Pflege gearbeitet und da hab ich sowas nie erlebt.
Janis, 36 Jahre, Sachbearbeiterin Finanzdienstleistung
Von Kostümen und Masken
Ich bin Schneider in der Kostümabteilung vom Staatstheater Nürnberg. Das Theater bleibt geschlossen. Durch die Schutzmaßnahmen können wir keine Anproben mehr machen, weil da der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Also habe ich jetzt fünf Wochen Zeit bekommen. Mir macht es auch nichts aus, dass ich die meiste Zeit zuhause verbringen muss, weil ich sowieso hier meine Werkstatt habe.
Ich hätte die Zeit gut damit verbringen können, auch mal was für mich zu tun oder für meine Familie zu nähen. Aber irgendeinen Beitrag wollte ich schon auch zur Krise leisten und bin dann mit meiner Nachbarin, die hobbymäßig näht, draufgekommen, dass wir mal so Gesichtsmasken nähen. Dieser eine Instagram-Post auf meiner Seite hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und durch einen Artikel in der deutschen Handwerkszeitung kamen dann Anfragen noch und nöcher. Ich bin jetzt auf alle Fälle sehr gut beschäftigt und nähe die ganze Zeit diese Masken. Mit den ganzen Bestellungen muss ich so vier bis 500 Masken nähen. Es sind auch Betriebe dabei, die gleich alle Mitarbeitenden ausstatten möchten.
Ich finde es schwierig, dass ich jetzt immer Distanz zu Menschen halten muss. Eigentlich umarme ich Menschen, die mir nahestehen oder aus meiner Familie. Das sind kleine Dinge, die mir fehlen. Diese Zeit ist gut dafür, dass ich kleine Dinge im Leben, die mir wichtig sind, wieder mehr zu schätzen weiß. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen freundlicher sind als vorher. Wenn ich spazieren gehe, grüßen mich viel mehr Menschen als vorher. Die Grundstimmung ist lockerer, weil alle jetzt entschleunigt sind.
Ich habe keine Angst vor dem Virus. Ich bin vielmehr jeden Tag dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und hier in Frieden leben kann. Es ist wichtig, dass ich positive Gedanken habe. Und besonders krass finde ich die Aktion mit den Masken. Das tolle ist: Ich knüpfe da jetzt Kontakte, die ich sonst nie bekommen hätte, weil die Anfragen über den Zeitungsartikel kommen ja wirklich deutschlandweit. Da finden Verknüpfungen statt und ich lerne neue Leute kennen. Es gibt positives Feedback und die Leute wissen es zu schätzen, dass ich helfen möchte. Es sind schöne kleine Erlebnisse, an die ich mich sicher immer erinnern werde.
Felix, 22 Jahre, Maßschneider am Staatstheater Nürnberg
Mit Henri im Kleinraumbüro
Henri hat eine Frage. Er soll in seinem Klassenzimmer nach Tieren suchen, deren Namen aufschreiben und Selbstlaute farbig markieren. In diesem Klassenzimmer aber hängen keine Tierposter an der Wand. Ein Bett steht hier, zwei Schränke, zwei Kommoden und zwei Schreibtische. Und statt Agustin, Mila und Koray sitzt Henri nur seinem Papa gegenüber. Der sagt, dass er schon einmal eine Ameise hier gesehen hat (stimmt nicht) und dass Ben am Morgen Wuffi, den Plüschhund im Bett von Mama und Papa vergessen hat. Also: AmEIsE, HUnd.
Seit neun Tagen sitzen Henri, neun Jahre alt, und ich, zweiundvierzig, in unserem Kleinraumbüro unter dem Dach. Wir markieren Selbstlaute, er für die Schule, ich für die Nürnberger Nachrichten. Die Stimmung ist bestens, was aber vor allem daran liegt, dass die Mama noch nicht wieder jeden Tag arbeiten muss und alles wirklich Wichtige erledigt: den täglichen Plan (8.15 Uhr: Frühstück; 9 Uhr: Mathematik; 10 Uhr: Deutsch; 11 Uhr: Sport mit Alba Berlin…) auf die Tafel schreiben; kochen; putzen; den fünf Jahre alten Ben beschäftigen. In der dritten Woche müssen wir allerdings in ein größeres Kleinraumbüro umziehen. Dann werden vielleicht auch die Konflikte größer.
Ben klopft. Er hat auch eine Frage. Ob wir mit Deutsch schon fertig sind. Ja. Er nickt anerkennend. Und stapft wieder nach unten. Dass Papa am Tag zuvor zum ersten Mal einen Podcast aus dem Schlafzimmer („Unter Quarantäne“ auf nordbayern.de) produziert hat, fand er nicht so beeindruckend. Später führe ich vielleicht mein erstes Instagram-live-Video. Ben wird das auch egal sein. Ben interessiert sich für die Sportstunde, für die Schnitzeljagd am Nachmittag und die Disko vor dem Abendessen. Jeder darf sich je ein Lied wünschen. Die Playlist wird uns immer an eine Zeit erinnern, in der alles anders war.
Hoffentlich werden wir mit einem Lächeln daran zurückdenken. Mama und Papa, beide Journalisten, lesen seit Wochen beängstigende Texte, sehen auf Twitter erschütternde Videos. Die Angst aber hat sich noch nicht in unser Haus geschlichen. Die Omas und Opas sehen bei den Video-Anrufen gesund und gelassen aus. Die Ur-Oma ist entspannt. Wer im Bombenhagel über Regensburg über die Steinerne Brücke hatte rennen müssen, lächelt im Alter von 93 Jahren über die Aufregung derer, die in diesen Tagen nicht genug Klopapier und Trockenhefe zu Hause haben können. An Ostern hätte sie uns zum traditionell ausufernden Familienbrunch besucht. Der Gedanke daran macht mich traurig. Aber nicht lange. Henri hat eine Frage.
Sebastian, 42 Jahre, Sportredakteur
„Wir sind die einzigen, die vorbeikommen.“
Es hat sich ganz viel geändert. Viele Leute sind verunsichert, ob es gut ist, dass wir überhaupt noch kommen. Etliche haben abgesagt und wollen, dass wir nicht mehr kommen. Das ist nicht einfach, denn wir haben einen Auftrag von den Ärzten und wir können nicht einfach sagen, dass wir nicht mehr kommen. Wir müssen dann mit dem Hausarzt Rücksprache halten und die Kunden müssen ihre Unterschrift geben, damit wir abgesichert sind, wenn wir nicht mehr kommen. Es tauchen viele rechtliche Fragen auf, und ich muss viel mehr improvisieren. Ich bin sehr angespannt und auch zum Teil verunsichert.
Der Redebedarf bei den Leuten ist deutlich gestiegen. Manche verstehen gar nicht, was abgeht. Manche Fragen kann ich auch nicht beantworten. Ich tröste die Leute. Und da kann ich nicht sagen, das geht jetzt wochenlang. Da kriegen die den Vogel. Die Leute sind so froh, dass wir kommen, weil sonst keiner mehr kommt. Da ist alles weg. Die ganz alten Menschen sind auch nicht so fit, dass sie über soziale Medien Kontakt halten können.
Grade in dieser Situation spüre ich, wie wichtig es ist, dass es ambulante Dienste gibt, die ohne großen Aufwand Menschen zuhause versorgen können auch mit den Anverwandten. Denn jede*r hat Angst, ins Heim zu kommen und sich dort anzustecken. Es gibt ja auch keine Kurzzeitpflege im Moment. Wir sind für viele der einzige soziale Kontakt. Wenn es uns nicht gäbe, das wäre die Katastrophe.
Auch die Kolleginnen sind verunsichert. Wann sollen wir Mundschutz tragen und wann nicht. Wir haben einen Personalnotstand und wenn jemand Corona kriegt, dann haben wir keinen Notfallplan. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das ist nicht geklärt. Eine Kollegin hat sich testen lassen, weil ihr Schwiegervater positiv war. Gott sei Dank ist sie doch gesund. Ich erwarte, dass wir in den nächsten Wochen alle getestet werden.
Aber es passieren auch tolle Sachen. Aus einer Kindergartengruppe haben die Kleinen zuhause einfach so Bilder für die alten Leute gemalt. Die hat die Erzieherin eingesammelt und uns gebracht, damit wir sie an die alten Leute verteilen. „Damit sie wissen, dass wir an sie denken.“
Marlen, 56 Jahre, stellvertretende PDL in der ambulante Altenpflege
Plötzlich im digitalen Klassenzimmer
Reine Heimarbeit als Lehrer? Das war früher unvorstellbar… Und plötzlich ist alles anders. Seit fast zwei Wochen unterrichte ich von zuhause aus. Das stellt mich täglich vor neue Herausforderungen: Erst einmal technischer Art. In den ersten Tagen der neuen Situation war die bayernweite Schulplattform MEBIS durch einen Hackerangriff lahmgelegt und völlig überlastet. Ich hatte Kurse für meine Schülerinnen und Schüler eingerichtet und Materialien bereitgestellt, aber die waren in den ersten Tagen kaum abrufbar. Also habe ich Materialien auf anderem Wege bereitgestellt und ich muss sagen, die Reaktion der Klassen war überwiegend positiv. Natürlich sind die neuen Zeiten auch eine didaktische Herausforderung: Als Sprachenlehrer habe ich Tondokumente aufgesprochen und an meine Schülerinnen und Schüler verschickt und Erklärvideos produziert. Es fehlt aber der persönliche Kontakt, es fehlt die direkte Interaktion. Dennoch machen die Schüler aus der neuen Situation das Beste: Ich erhalte eingescannte Hausaufgeben oder kleine, in der Fremdsprache gesprochene AUDIO-Dateien. Wir haben einen Wochenplan vereinbart und die meisten halten sich daran. Eine Schülerin hat mir geschrieben, dass für sie die neue Art von Unterricht „viel anstrengender“ ist als der „normale Unterricht“. Das kann ich nachvollziehen, aber ich sehe in der schwierigen Situation durchaus auch ein Chance: Ich habe noch nie so intensiv mit meinen Kolleginnen und Kollegen über digitalen Unterricht diskutiert und noch nie wurden so schnell viele Schülerinnen und Schüler an einen freieren und vielleicht weniger lehrerzentrierten Unterricht herangeführt.
Reinhard, 48 Jahre, Lehrer
Büro mit Familienanschluss
„Ich bin sehr froh, dass es in meinem Beruf möglich ist, von zu Hause zu arbeiten. Das ist ja nicht überall möglich und für viele, gerade Alleinerziehende, gar nicht so einfach, das in der momentanen Situation mit den Kindern unter einen Hut zu bekommen. Allerdings ist es sehr gewöhnungsbedürftig, wenn Mann und Kind auch zu Hause sind. An manchen Tagen ist es auch sehr schwer sich zu motivieren den Rechner hoch zu fahren und etwas zu tun. Nach nun drei Wochen Homeoffice habe ich es mir wieder angewöhnt, mich morgens anzuziehen, als ob ich rausgehen würde und mich nicht im Hausgewand an den Rechner zu setzen. Die Schwierigkeit ist, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. Ich sitze dann mit meiner Tochter zusammen am Arbeitstisch und jeder erledigt seine Arbeit. Zumindest sollte das so sein. Aber entweder kann sich meine Tochter nicht konzentrieren, weil ich nebenher telefoniere. Oder aber sie braucht meine Hilfe, weil sie etwas nicht verstanden hat, und ich komme dann nicht zum Arbeiten. Ab elf Uhr muss ich mich dann schon wieder um das Mittagessen kümmern. Zeitlich alles etwas stressig.
Da mir am meisten meine Kollegen fehlen, helfen mir im Moment die täglichen Telefonkonferenzen. Für die Familie haben wir uns einen Wochenplan aufgestellt, damit jeder sieht, um welche Uhrzeit er was zu tun hat. So ist der Tagesablauf etwas strukturierter. Ziel ist möglichst viel und intensive Zeit mit meinem Kind zu verbringen, denn für sie ist diese Situation auch eine große Herausforderung.
Trotz allen Schwierigkeiten bin ich überrascht, wie schnell die Zeit vorbei geht und es im Haus immer was zu tun gibt. Langweilig wurde uns bisher nicht.“
Melanie, 41 Jahre, Dipl.-Ing. (FH) und Vertriebsmitarbeiterin
Vom Hörsaal in den Supermarkt
Ich arbeite erst seit ein paar Tagen im Supermarkt und fülle Regale auf. Vorher waren Semesterferien und ich habe Führerschein gemacht aber jetzt kann ich keine Theorie- und Praxisstunden mehr machen. Ich habe mich auf Ausbildungsstellen beworben und Praktikumsstellen gesucht aber im Vorstellungsgespräch haben sie gesagt, im Moment kann niemand ein Praktikum machen. Beim Kino habe ich mich auch um einen Aushilfsjob beworben aber das hat jetzt auch zu. Und dann bin ich einfach in die Supermärkte gegangen und hab mich beworben. Ich war echt überrascht, dass ich praktisch von einem Tag auf den anderen eingestellt wurde.
Im Supermarkt sieht man immer mehr Leute mit Atemschutzmaske. Die Kassen sind mit Plastikscheiben geschützt und ich soll Abstand zu den Kunden halten. Den Arbeitskollegen sollen wir nicht die Hand schütteln und generell Handschuhe tragen. Es wird viel mehr gekauft und die Regale sind sehr schnell leer. Klopapier, Fertiggerichte und Hefe sind extrem schnell weg. Ich wurde ultra oft gefragt, ob noch Hefe da ist. Der Supermarkt hat aber viel Ware im Lager und jeden Tag werden Waren geliefert. Ich höre, wie Kunden sich unterhalten, weil es ein gemeinsames Thema gibt. Manche kennen sich und treffen sich beim Einkaufen. Ich finde es positiv, dass ich was zu tun habe. Das ist besser als zuhause sitzen und nichts tun. Meine Kollegen sind sehr nett und geduldig, obwohl sehr viel zu tun ist. Trotz der Ausnahmesituation sind die ruhig und gelassen. Das ist schon nice.
Jonas, 20 Jahre, Student